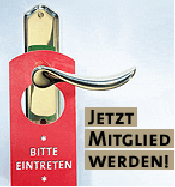Acht Überlegungen zu den Landtagswahlen am 13. März 2016
Acht Überlegungen zu den Landtagswahlen am 13. März 2016
1. Nach unten offen
In drei Ländern gab es drei verschiedene Wahlsieger, die gleichzeitig bei den anderen Wahlen Niederlagen oder desaströse Ergebnisse einfuhren. Die SPD legt in Rheinland-Pfalz zu, gewinnt entgegen der Prognosen und halbiert sich zugleich in den beiden anderen Ländern und landet auf einem für unvorstellbar gehalten niedrigen Niveau. Die Grünen erzielen in Baden-Württemberg einen historischen Triumph und verlieren im benachbarten Rheinlad-Pfalz gleichzeitig 2/3 ihrer Wähler. Die CDU behauptet sich in Sachsen-Anhalt als stärkste Kraft und kassiert in Baden-Württemberg eine historische Schlappe und fährt auch in Rheinland-Pfalz das schlechteste Ergebnis aller Zeiten ein.
Wie schon der Absturz der FDP bei der Bundestagswahl 2013 gezeigt hat, kann es für alle Parteien atemberaubend schnell und fast unbegrenzt nach unten gehen. Dies zeigt, dass für alle Parteien die verlässlichen Bastionen der Stammwähler erodieren und sich mittelfristig vollständig aufgelöst werden haben. Das hat mit der Veränderung in der Gesellschaft und der sie prägenden Milieus zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass sich die Parteien programmatisch so sehr angenähert haben, dass für die allermeisten Wähler die etablierten Parteien grundsätzlich alle wählbar sind.
Daraus resultiert, dass die Ausschläge größer werden. In vielen anderen europäischen Ländern ist das schon lange Normalität. Dort steigen Parteien aus dem Nichts auf oder schaffen es in wenigen Jahren von der führenden Regierungspartei zu einer kaum mehr existenten Splitterpartei zu werden.
Das Beispiel der FDP zeigt aber auch, dass das gefühlte Ende nicht das tatsächliche Ende sein muss. Noch vor zwei Jahren war die FDP fast nicht mehr existent. Am 13. März erzielten sie indes in Baden-Württemberg und Rheinlad-Pfalz Ergebnisse, die sich auf dem Niveau der letzten Jahrzehnte bewegen.
2. Das Ende der Volksparteien?
Für die SPD und die CDU bedeutet die Volatilität der Wahlergebnisse ein ungleich größeres Problem als für die kleineren Parteien, da diese das Konzept der Volkspartei und dem daraus resultierenden politischen Bindungs- und Vertretungsanspruch in Frage stellt.
Grundsätzlich scheint die Anziehungskraft des Konzepts Volkspartei ungebrochen. Sowohl die Grünen in Baden-Württemberg als auch die AFD in Sachsen-Anhalt reklamieren für sich, neue Volksparteien zu sein. Einmalig hohe Wahlergebnisse konstituieren jedoch ebenso wenig die Geburt einer Volkspartei wie schlechte Wahlergebnisse das Ende der beiden Volksparteien SPD und CDU.
Es ist jedoch mit Blick auf die Veränderungen in der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten festzustellen, dass sich die Zeit milieuorientierter Volksparteien dem Ende entgegen neigt. Volkspartei zu bleiben oder zu werden wird nur den Parteien gelingen, die das Konzept der Volkspartei neu erfinden. Ein Ansatzpunkt könnte eine wertebasierte bzw. werteorientierte Volkspartei sein. So müsste die SPD sichtbar, durchgängig und durch politischen Entscheidungen belegt auf Gerechtigkeit und den Zusammenhalt der Gesellschaft zielen und so einem breiten Teil der Bevölkerung ein glaubwürdiges und stringentes Politik- und Gesellschaftsangebot machen.
Ein Konzept hingegen, das darauf setzt alle gesellschaftlichen Strömungen und Positionen zu integrieren führt nicht in eine Volkspartei neuer Art, sondern zu einer Partei, die weder greifbar noch wahrnehmbar und in ihrer Beliebigkeit auch durch jede andere ersetzbar ist. Die SPD hat am 13. März erlebt, welche Ergebnisse möglich sind, wenn sich als nicht wahrnehmbar oder greifbar erlebt wird.
3. Es ist viel möglich für viele
In einer politischen Landschaft, in der es steil nach unten geht, kann es ebenso steil nach oben gehen. Es ist mitnichten alles gut, für keine der großen Parteien und schon gar nicht für die SPD. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass wir es selber in der Hand haben (ebenso wie die anderen Parteien), Wahlen zu gewinnen. Wahlen gewinnen auch zukünftig die, die klare Positionen haben und somit für die Wählerinnen und Wähler einen echten Grund anbieten, ihr Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. (Das gilt auch für Parteien, die darauf abzielen „Protestwähler“ zu mobilisieren). Positionen und politische Ziele werden jedoch nur in der Zuspitzung sichtbar und nur dann glaubwürdig, wenn sie geschlossen verfolgt werden. Das Beispiel von Guido Wolf und Julia Klöckner zeigt, dass eine Absetzbewegung von der eigenen Partei immer nach hinten losgeht, da sie den Wähler primär ratlos zurücklassen. Orientierung statt Ratlosigkeit ist es aber, wonach die Wähler in einer Zeit rapider Veränderungen, internationaler Krisen und einer starken Zunahmen der Komplexität der wahrgenommenen Welt, dürsten.
Für die Bundestagswahlen bedeutet das, dass die SPD ohne Verlässlichkeit, Orientierungsangebot und Geschlossenheit keine Chance haben wird.
4. Auf Personen kommt es an
In Sachen Orientierung und Identifikationsangebot kommt es wesentlich auf das politische Spitzenpersonal an. Jedenfalls für die Parteien, die den Anspruch haben, die Regierung zu stellen. Die Bindungskraft der MinisterpräsidentInnen hat sich am 13. März als enorm erwiesen. Dies belegt die These, dass in politischen Krisenzeiten der Wunsch nach politischer Führung durch vertraute und glaubwürdige Köpfe groß ist. Für Juniorpartner einer Koalition oder die SpitzenkandidatInnen aus den Reihen der Opposition ist das eine schlechte Nachricht. Um aus der Opposition oder der Rolle des Juniorpartners dennoch Punkte zu machen, bedarf es ausstrahlungskräftiger KandidatInnen. Der Typus des braven Bürokraten mag als Amtsinhaber Aussicht auf Erfolg haben. Ein ebenso langweiliger Juniorpartner / Oppositionspolitiker hat jedoch ein drastisches Wahrnehmungs- und Orientierungsproblem. Auch das konnte man am 13. März beobachten.
Der Protest braucht hingegen kein Gesicht. Die Erfolge der AFD sind sicherlich nicht dem jeweiligen Spitzenpersonal in den Ländern zuzurechnen. Vielmehr ist es ihr gelungen, sich als breite Projektionsfläche eines enormen Protest- und Angstpotenzials anzubieten.
5. Das Geschäft mit der Angst durchbrechen
Der Erfolg der AFD hängt nicht zuletzt mit ihrem geschickten Umgang mit den in der Gesellschaft vorhandenen Ängsten zusammen. Einem Umgang, der sich fundamental von den Strategien aller anderen Parteien unterscheidet.
Oft ist zu hören, dass die Rechtspopulisten Ängste schüren. Dieser Satz ist sicher richtig, verstellt aber zugleich den Blick auf eine gesellschaftliche Realität. Völlig unabhängig von der Existenz und dem Wirken der Rechtspopulisten gibt es seit vielen Jahren verschiedene Ängste, die vor allem Abstiegs- und Verlustängste sind und unter anderem aus einer Überforderung der Menschen mit gesellschaftlichen Veränderungen resultieren. Diese Ängste werden von den Parteien seit Jahren ignoriert oder gar negiert. Immer wieder ist zu beobachten, wie Parteien und politische Funktionsträger versuchen, artikulierte Sorgen und Empfindungen wegzuargumentieren. Statt auf das Gesagte einzugehen, erklärt man den Leuten, wie sie doch mit Blick auf die Realitäten eigentlich zu empfinden hätten. Derartige Erfahrungen sind nicht selten der Ausgangspunkt für einen tiefgreifenden politischen Entfremdungsprozess. Die Leute fühlen sich schlicht nicht mehr ernst genommen.
Populisten und Extremisten, die den Menschen das Gefühl vermitteln, dass ihre Ängste gehört würden, berechtigt seien und politisch berücksichtigt würden, ist damit das Feld bereitet. Ihre Rhetorik, die Ängste bedient und tatsächlich oder vorgebliche Gefahren beschwört sorgt für eine Konjunktur der Angst, der die anderen Parteien, die verlernt haben, auf Sorgen zu reagieren oder auch nur über sie ins Gespräch zu kommen, nichts entgegen setzen können.
Wer das Geschäft mit der Angst verhindern will, muss die Fähigkeit zum politischen Gespräch über Sorgen und Ängste zurückgewinnen. Es reicht nicht aus Menschen, die Angst vor „Überfremdung“ und dem Verlust von Arbeitsplätzen durch Zuwanderung haben, wahlweise entgegenzuhalten, dass es Quatsch sei was sie empfinden oder dass sie Nazis seien. Die Antwort ist eine echte Auseinandersetzung, die an dem anknüpft, was die Menschen erleben und empfinden, ohne der Versuchung lauter Abgrenzung oder vorgeblich schneller und einfacher Antworten zu erliegen, die auch von den Populisten stammen könnten.
6. Auf die Alternativen kommt es an
Die bereits erwähnte programmatische Annäherung der Parteien bildet zum einen ab, dass es in Deutschland einen relativ breiten politischen Konsens in vielen Fragen gibt und zum anderen, dass die Parteien über ein in Jahrzehnten gewachsenen Aushandlungsmodell zur Schaffung von Kompromissen verfügen. Das stellt einen wesentlichen Unterschied zu den in diesen Tagen oft in Erinnerung gerufenen Zuständen der Weimarer Republik dar und ist durchaus Anlass zur Beruhigung.
Gleichzeitig ist das Schwinden der Unterschiede zwischen den Parteien eine Ursache für die im Wortsinne erschütternden Erfolge der AFD. Wer mit der aktuellen Politik und dem politischen Konsens nicht einverstanden ist, dem werden im Spektrum der demokratischen und humanen Parteien kaum Alternativen geboten. Das gilt sowohl für die Gesellschaftspolitik als auch die Außenpolitik oder die Sozialpolitik. Die Unterschiede, die es zweifellos gibt, sind insbesondere für den weniger involvierten und nicht tagesaktuell informierten Menschen schwer auszumachen.
Wenn irgendwie alle gleich erscheinen, dann fällt es einer Partei wie der AFD leicht, sich ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen. Die AFD grenzt sich rhetorisch und tatsächlich ab und bietet damit eine Plattform für alle, die immer schon mal zeigen wollten, dass sie das eine oder andere grundsätzlich anders sehen oder aber, die sich von der gesellschaftlichen Entwicklung abgekoppelt fühlen oder aber ihre Unzufriedenheit mit der Alternativlosigkeit zum Ausdruck bringen wollen.
Sowohl für die Entwicklung der Gesellschaft als auch die demokratische Kultur sowie den Akt des Wählens, der mehr als Auswahl des Spitzenpersonals sein soll, wäre es wünschenswert, wenn die Parteien, den Mut zu mehr Unterschiedlichkeit fänden und sich trauten, politische Alternativen zu entwickeln und auszuprobieren. Dort wo es tatsächliche Alternativen gibt, wird es der AFD kaum gelingen, sich als das zu präsentieren, was sie in ihrem Namen behauptet.
7. Unterschiede muss man aushalten können
Paradoxerweise wünschen sich viele mehr Unterschiede, können sie – vor allem im politischen Betrieb – aber schlecht aushalten. Das gilt sowohl in den Parteien als auch zwischen den Parteien und nicht selten vor allem dann, wenn diese Unterschiede tatsächlich nur gering sind.
Bei nahezu jeder politischen Diskussionsrunde und vor allem auch in Parlamentssitzung kann man es erleben, dass unterschiedliche Auffassungen als Skandal betrachtet, bezeichnet und behandelt werden. Es fällt offenbar schwer zu akzeptieren, dass andere Menschen mit durchaus vernünftigen Argumenten zu anderen politischen Schlüssen kommen als man selbst oder die eigene Partei. Statt sich auf Argumente einzulassen, findet eine scharfe rhetorische Abgrenzung statt, die nicht selten dem anderen intellektuelle oder charakterliche Defizite unterstellt. Man muss den Eindruck bekommen, dass eine andere Meinung entweder das Ergebnis von Dummheit oder bösen Absichten sei.
Auch hier ist ein Mangel an politischer Gesprächsfähigkeit zu besichtigen, der sich auf die gesamte politische Kultur auswirkt. Zum einen führt das dazu, dass sich Menschen aus dem politischen Diskurs zurückziehen, weil sie keine Lust haben, dass ihre Meinung unter den Verdacht der Dummheit oder Bösartigkeit gestellt wird. Zum anderen wird wiederum das Feld für populistische Kräfte bestellt, die an das selbstgezeichnete Bild der anderen Parteien und das Ressentiment vom Parteiengezänk anknüpfen und dem sie die Durchsetzung des „eigentlichen Volkswillens“ und des „gesunden Menschenverstandes“ entgegensetzen.
Die Parteien und Politikerinnen und Politiker täten sich und der demokratischen Kultur einen großen Gefallen, wenn sie dem Argument der anderen und der Unterschiedlichkeit der Positionen mehr Wertschätzung zuteilwerden ließen. Differenz ist kein Grund für Erregung, sondern das Ziel der demokratischen Auseinandersetzung.
8. Raus aus der Skandalisierungsfalle
An tatsächlichen politischen Problemen und Risiken gibt es aktuell in Europa und der Welt keinen Mangel. Entsprechend ist es kein Wunder, dass sich viele Menschen Sorgen machen und das Gefühl haben, in haltlosen Zeiten zu leben. Der Eindruck, in einer in Unordnung geratenen Welt zu leben (obwohl die meisten Menschen in diesem Land ganz gut leben und eine Menge davon besser als je zuvor), wird durch politisches Handeln bestärkt.
Die Politik ist in einem permanenten Skandalisierungsmuster gefangen. Jeder Anlass, jedes tatsächlich - oder aber auch nur konstruierbare - politische und gesellschaftliche Problem wird von den politischen Akteuren begierig aufgegriffen und skandalisiert. Dies folgt dem Muster bzw. der Hoffnung, dass das Problem des anderen der eigene Vorteil am nächsten Wahltag sei. Egal ob es die Einführung einer Umweltzone, die Verzögerung beim Bau von was auch immer, die Erhöhung einer Steuer oder die Abschaffung einer Gebühr ist, immer ist es Anlass für enorme Aufregung heftige Vorwürfe.
Das Problem besteht nicht darin, die Dinge anzusprechen, ihnen auf den Grund zu gehen und Alternativen einzufordern oder anzubieten. Das Problem besteht darin, immer mit der ganz großen Skandalkeule aus dem politischen Gebüsch zu springen. Denn das hat Konsequenzen, wie man an der politischen Stimmung im Land und den Wahlergebnissen sehen kann.
Zunächst führt es dazu, dass die permanente Erregung zum politischen Normalzustand wird und sich das Bild einer aus den Fugen geratenen Welt und Gesellschaft festsetzt. Es wächst der Wunsch nach einer starken und ordnenden Hand. Unter anderem auch deshalb, weil man den Eindruck bekommt, es auf den politischen Führungsebenen vorrangig mit Idioten, Versagern oder Verbrechern zu tun zu haben. Gleichzeitig wird der Eindruck erweckt, dass es für alle diese Probleme einfache und schnelle Lösungen gäbe, wenn man erst mal selber regiere und diejenigen, die Schuld an diesem oder jenen seien, vom Wähler davon gefegt worden seien. Der Gedanke, dass es nicht für jedes Problem, jede Herausforderung oder schwierige Situation einen Schuldigen und eine einfache Erklärung gibt, ist nicht mehr besonders populär. Die geweckte Erwartungshaltung, kann nur enttäuscht werden. Da das in der Regel nicht dazu führt, dass das über Jahre gelernte Konzept, dass es für alles eine einfache Erklärung und schnelle Lösung gebe, hinterfragt wird, landen die Enttäuschten nicht selten bei den Populisten, die noch ein bisschen brutaler die einfachen Lösungen postulieren und überdies noch nie in der Verlegenheit waren, in Regierungsverantwortung ihre behauptete Problemlösungskompetenz unter Beweis zu stellen.
Auch hier liegt es an den politisch Handelnden, dem Populismus den Nährboden zu entziehen und der demokratischen Kultur ein bisschen auf die Beine zu helfen. Der vermeintlich schnelle und einfache Vorteil, der der eigenen Partei aus dem permanenten Skandal erwachsen soll, ist am Ende meist ein Nachteil für alle. Zumindest für die, die keine Populisten sind. Auch das konnte man am 13. März in allen Bundesländern erkennen.