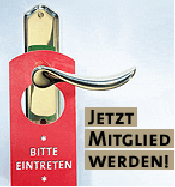Ein Volksentscheid ist ein Volksentscheid ist ein Volksentscheid
26.05.2014: Sieben Überlegungen zum Ausgang des Volksentscheids über das Tempelhofer Feld am 25. Mai 2014
1. Die Entscheidung ist eindeutig
Die Berlinerinnen und Berliner haben sich in großer Zahl und mit einer beachtlichen Mehrheit für den Gesetzentwurf „100 % Tempelhofer Feld“ entschieden. Für die Initiative als Träger des Volksentscheids ist das ein großer Erfolg. Die Wählerinnen und Wähler konnten sich zwischen zwei eindeutigen, sich deutlich unterscheidenden und breit kommunizierten Alternativen entscheiden, deren Vor- und Nachteile ausführlich im Vorfeld des Wahltages öffentlich diskutiert wurden. Die Entscheidung für den Gesetzentwurf war also eine bewusste. Es wäre absurd und widerspräche dem gebotenen Respekt vor dem Souverän zu behaupten, dass die Mehrheit nicht wüsste, wofür sie sich entschieden habe.
2. Der Entscheid gilt
Schon im Vorfeld der Entscheidung wurde immer wieder darüber diskutiert, dass man dem Volksgesetz erst zustimmen und es dann im Parlament ändern könnte, um mögliche negative Konsequenzen des Gesetzes abzumildern. Ich halte das für ausgeschlossen. Ein Volksgesetz gilt und kein Parlament, das halbwegs bei Trost ist, würde dieses Gesetz umgehend ändern. Es wäre respektlos, eine Uminterpretation der bewussten Entscheidung der Berlinerinnen und Berliner vorzunehmen und damit eine Änderung des Gesetzes durch das Abgeordnetenhaus zu begründen.
3. Antworten auf die Wohnungsnot werden weiter dringend gesucht
Wie kein anderes Thema beherrschen der Anstieg der Mieten und die fehlenden Wohnungen meine politische Arbeit in Schöneberg. Viele Menschen treibt das Thema um. Sie sind in Sorge über kommende Entwicklungen oder haben bereits heute große Probleme durch Mietsteigerungen, Verkauf oder Modernisierung ihrer Wohnung. Wohnen ist die neue soziale Frage in Berlin. Immer wieder wird die unmissverständliche Erwartung an mich formuliert, dass wir politisch gegensteuern und Lösungen für dieses Problem finden müssten. Der Bau von vielen neuen öffentlichen Wohnungen ist aus meiner Sicht eine Antwort auf dieses Problem. Der Volksentscheid zeigt, dass diese Antwort im Konkreten keine ausreichende Unterstützung erfährt. Die noch von niemandem beantwortete Frage ist, wie man ohne Neubau von Wohnungen landespolitisch wirksame Antworten auf die Folgen der stark steigenden Bevölkerungszahlen in Berlin geben kann. Unsere politische Aufgabe besteht darin alternative Konzepte zu entwickeln und weiter für die Akzeptanz von Wohnungsneubau zu werben.
4. Tempelhof ist für den Wohnungsbau nicht alles, verändert aber viel
In vielen Diskussionen über die Zukunft des Tempelhofer Feldes wurde darauf hingewiesen, dass es viele andere Flächen in Berlin für Wohnungsbau gebe und die am Rand des Felds geplanten Wohnungen allein das Mietenproblem nicht lösen würden. Beides ist richtig. Und dennoch hat das Nein zur Randbebauung aus meiner Sicht weitreichende Konsequenzen für den Bau von Wohnungen und damit die Mietenwicklung. Die Berlinerinnen und Berlinern haben dem vollständigen Erhalt einer Freifläche den eindeutigen Vorrang gegenüber dem Bau von Wohnungen am Rand eingeräumt. Es ist davon auszugehen, dass künftig bei anderen Neubauvorhaben die Forderung erhoben wird, auch in diesem Fall dieser für Tempelhof eindeutigen Willensbekundung des Volkes zu folgen und dem Neubau eine Absage zu erteilen. Das Bauen in der Stadt wird also noch sehr viel schwerer werden. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren noch mehr bebauende Gelände zu „kleinen Tempelhofer Feldern“ erklärt und der Neubau bekämpft werden wird. Schon heute entsteht in Schöneberg zu fast jedem Bauprojekt eine Bürgerinitiative, die sich gegen den Bau und für den Status quo ausspricht. Theoretisch gibt es also genug Platz für Wohnungen. Praktisch wird der Neubau im Konkreten aber fast überall bekämpft und seit dem 25. Mai 2014 kann man stets darauf verweisen, dass die Mehrheit der Berliner das auch so sehe. Für Parteien, die sich nichts mehr wünschen als mehrheitsfähig zu sein und Wahlen zu gewinnen ist es eine große Verlockung, auf diesen Kurs einzuschwenken.
5. Die Sache mit der Beschleunigung und dem Wandel der Stadt
Berlin hat sich in den letzten Jahren ungeheuer verändert. In vielen Reden, Artikeln und Essays werden die Dynamik und der permanente Wandel gepriesen. Nicht nur Berlin als Stadt, sondern auch die Arbeitswelt und die alltäglichen Formen der Kommunikation und die Organisation des Alltages haben sich global rasant gewandelt. Vielen Menschen macht dieser Wandel im Kiez, im Leben und in der Welt offenbar mehr Sorgen als Spaß. Der Veränderungs- und Anpassungsdruck sind für den einzelnen enormen Stress. Ich verstehe das Votum für den Erhalt des Tempelhofer Feldes in seiner heutigen provisorischen Form auch als Wunsch, die Beschleunigung der Stadt zu verlangsamen und für Orientierung durch Erhalt des Bestehenden zu sorgen. Ich kann diesen Wunsch nachvollziehen. Ich fürchte allerdings, dass sich dieser Wunsch über diesen Volksentscheid nicht erfüllen lässt. Er ist als Handlungsanweisung für die politisch Handelnden nicht geeignet, da die Beschleunigung und der Wandel nicht das Ergebnis eines gesteuerten politischen Prozesses, sondern einer friedlichen Revolution in Europa mit sich anschließender beschleunigter Globalisierung und einer digitalen Revolution auf der ganzen Welt sind. Wenn man heute in Berlin seinen Kiez nicht wiedererkennt, dann liegt das in den seltensten Fällen an den politisch erzeugten Großprojekten, sondern am Austausch der Wohnbevölkerung, am Aussterben des traditionellen Einzelhandels, der Eröffnung neuer Gastronomie und der Sanierung privater Wohnhäuser. Für alles das setzt der Staat den Rahmen. Verantwortlich für die Veränderungen an sich sind aber die Menschen, die sich entscheiden, nach Berlin zu kommen, andere Produkte auf anderen Wegen zu kaufen, ihren Kaffee in der Espresso-Bar und nicht zu Hause zu trinken und lieber in der Innenstadt zu leben und nicht mehr im eigenen Häuschen am Stadtrand.
Der Verzicht auf große Vorhaben, wie das Tempelhofer Feld zu entwickeln, wird den Wandel kaum bremsen, sondern ihn dezentralisieren, in die Kieze tragen durch zum Beispiel den Ausbau von Dachgeschossen, die Bebauung von noch bestehenden Baulücken und einen eher steigenden Verdrängungsdruck. Politisch ist daraus die Konsequenz zu ziehen, die negativen Folgen des Wandels für den einzelnen stärker zu beachten, alles dafür zu unternehmen, dass es möglichst weniger Verlierer der rasanten Veränderungsprozesse gibt und gleichzeitig ein politisches Konzept für eine Entwicklung der Stadt im Dialog zu entwickeln. Es wäre fatal aus dem Volksentscheid die Konsequenz zu ziehen, die Entwicklung der Stadt als Ziel aufzugeben, allein den Status quo zu verteidigen und es dem freien Spiel der Kräfte zu überlassen, wie sich die Dinge in der Stadt verändern.
6. Die Sache mit den Großprojekten
Wenige Dinge haben in dieser Zeit ein geringeres Ansehen als große Bauprojekte. Das gilt erst recht, wenn es sich dabei um öffentliche Vorhaben handelt. An Ursachen für dieses komplexe Phänomen mangelt es nicht. Eine wesentliche Ursache liegt sicherlich im schlechten Management und der fehlenden Aufrichtigkeit über Umfang, Kosten und Konsequenzen öffentlicher Großprojekte, für die wir alle viele Beispiele präsent haben. Die große Veränderung der Stadt, die von Großprojekten ausgeht bzw. Großprojekten zugeschrieben wird ist ein weiterer wichtiger Grund für die Ablehnung (siehe oben).
Welche politischen Konsequenzen sind daraus zu ziehen? Eine naheliegende und auch in den letzten Wochen immer wieder geäußerte Auffassung ist, dass man einfach die Finger von solchen Vorhaben lassen solle. Das war ein wichtiges Argument für das Volksgesetz 100 Prozent Tempelhof. Wenn man ehrlich ist, kommt man aber zum Schluss, dass das nicht klappen wird. In einer großen Stadt wie Berlin ist die Sanierung einer historischen Oper oder der Bau eines Bahnhofes immer ein Großprojekt. Die Finger davon zu lassen würde bedeuten, die öffentliche Infrastruktur, die Substanz der Stadt nach und nach verfallen zu lassen oder sie an Private zu übertragen. Beides wäre nicht gut für Berlin. Im Kleinen sein Glück zu finden und das Große sein zu lassen wird für eine Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern nicht funktionieren.
Alle politischen Kräfte, denen an öffentlicher Infrastruktur, von der alle Menschen in einer Stadt profitieren, gelegen ist, sollten dafür kämpfen, dass gemeinsame große Vorhaben wieder möglich werden. Der erste Schritt ist es, Vorhaben tatsächlich zu gemeinsamen Vorhaben zu machen und die Bevölkerung einzubeziehen. Es sollten auch die Abwägungen bei Entscheidungen ehrlicher dargestellt werden und nicht nur die eigenen Pläne bejubelt werden. Nichts ist nur positiv und alles hat auch negative Konsequenzen. Die Politik sollte den Mut haben das darzustellen und deutlich machen, dass man trotz gewisser negativer Folgen in der Gesamtabwägung mehr Vorteile sieht, die eine Entscheidung für ein Vorhaben vertretbar machen. Bei Großprojekten wird einem heute oft aus der Bevölkerung entgegengehalten: „Alles schlecht!“ Eine solche Aussage ist natürlich quatsch. Mit dem Spiel hat aber die Politik begonnen, in dem sie über Jahrzehnte immer gerufen hat „Alles toll an unseren Plänen“, was natürlich ebenso falsch ist.
Diese neue Ehrlichkeit könnte dann auch ein Schlüssel dafür sein, endlich eine vernünftige öffentliche Fehlerkultur zu erreichen. Es ist normal, dass bei größeren Vorhaben Dinge mal schief gehen. Das ist bei privaten Vorhaben nicht anders als bei öffentlichen. Im öffentlichen Raum wird indes jedes Problem zum Skandal gemacht und als vorgeblicher Beweis für die absolute Unfähigkeit politisch Handelnder herangezogen. Politisch Verantwortliche, die eigene Vorhaben als perfekt und alternativlos darstellen, sind für dieses blödsinnige politische Reaktionsmuster mindestens ebenso verantwortlich, wie diejenigen, die versuchen, auf jedem noch so kleinen Problem ein populistisches parteipolitisches Süppchen zu kochen. Einfach mal ehrlich sein könnte helfen und die Dinge in ihrer ganzen Komplexität darstellen und nicht aus jedem Thema eines machen, mit dem man seine eigene vermeintliche Großartigkeit und die vermeintliche Unfähigkeit des anderen versucht darzustellen.
7. Die Sache mit dem Vertrauen
Ich habe es in den letzten Wochen immer wieder erlebt, dass mir als Antwort auf die Darstellung unserer Pläne und Ideen für das Tempelhofer Feld ganz schlicht entgegen gehalten wurde: „Ich glaube euch nicht, dass ihr das so machen werdet.“ Oft hieß es auch: “Ich glaube euch nicht, dass ihr das nicht machen werdet“. Den positiven Plänen (öffentliche und günstige Wohnungen) wurde kein Glaube geschenkt und der klaren Absage an absurde und nicht belegte Behauptungen der Volksinitiative (Privatisierung, Bebauung der inneren Fläche) ebenso nicht. Natürlich können kein Mensch und keine Partei heute beweisen, wie ihr zukünftiges Handeln aussehen wird. Beweise führen lassen sich immer nur für frühere und gegenwärtige Handlungen. Kommt die Zukunft ins Spiel, geht es nicht um Beweise, sondern um Vertrauen. Genau dieses Vertrauen fehlt. Das Ausmaß des Vertrauensverlusts hat mich schockiert. So etwas habe ich das in vielen Jahren Straßenwahlkampf noch nie erlebt.
Ich habe immer wieder gefragt, warum meinen Ausführungen nicht geglaubt wird, warum es kein Vertrauen gibt, dass die Pläne von heute das Handeln von morgen sind. Ich habe viele Antworten bekommen: Die Politik im Allgemeinen lüge, nach dem BER könne man Wowereit und dem Senat nicht mehr glauben, Wahlversprechen, wie die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften, würden nicht umgesetzt, Verantwortung würde immer hin und her geschoben, die Regierungszeit der SPD sei zu lang, die Misere der Stadt mit fehlenden Lehrern und einer Privatisierung allen öffentlichen Eigentums, die Regelungsdiktatur der Politik.
Alle diese Erklärungen sind zutreffend, da sie unverblümt das Erleben des Einzelnen beschreiben. Auch wenn ich viele Dinge anders sehe, wäre es absurd den Leuten zu erzählen, dass das Problem in ihrer Wahrnehmung läge und nicht in der Sache. Der politische Gegner mag dies als Bestätigung sehen. Sicher ist es ganz normal, dass man nach einer langen Regierungszeit den Regierenden die Schuld für alle ungelösten Probleme gibt und ihnen vorwirft, die vielen Jahre an der Regierung nicht dafür genutzt zu haben, alle Probleme zu lösen.
Nach meinem Eindruck ist der Vertrauensverlust in die Politik aber ein grundsätzlicher, der über Klaus Wowereit und die SPD hinausgeht. Viele Menschen trauen den Parteien nicht zu, die sie drückenden Probleme schnell und einfach zu lösen. Das liegt daran, dass es für die meisten Probleme keine einfachen und schnellen Lösungen gibt. Keine Partei kann die bestehende Komplexität der Entscheidungsstrukturen und Wirkungsweisen der Politik ignorieren und schnelle und einfache Lösungen in Kraft setzen. Niemand hat den Knopf in der Tasche, auf den zu drücken ausreicht, um ein Problem zu lösen. Dummerweise tun Parteien und Politiker aber oft so als ob sie genau diesen Knopf besäßen und versprechen eine Handlungs- und Problemlösungskompetenz, die sie in einer immer komplexeren Welt mit sehr ausdifferenzierten Regelungsstrukturen gar nicht haben. Dieses Phänomen ist im parlamentarischen und politischen Alltag ein allseitiges. Die regierenden Politiker suggerieren, dass sie alles, aber auch wirklich alles im Griff hätten und sich allein durch ihre Handlungen der beste aller erreichbaren Zustände einstellen wird. Die opponierenden Politiker tun so, als ob alles auf einen Schlag besser und anders würde, wenn sie die Regierung stellen würden und alle ungelösten Probleme damit zusammenhängen, dass einfach die falschen regierten. Die Parteien erzeugen mit diesem Habitus die Erwartungshaltung, an der sie nur scheitern könnten.
Aus diesem Muster auszusteigen ist leider alles andere als leicht. Einer Partei, die sich ehrlich macht und die Ankündigung ihrer künftigen Handlungen an dem Möglichen misst, werden die Herzen und Stimmen eher nicht automatisch zufliegen. Die Ergebnisse der Europawahlen zeigen in ganz Europa, dass die mit den populistischen Parolen und den politischen Zauberformeln enormen Zulauf haben. Es ist mutet fast absurd an, dass ausgerechnet die populistischen Parteien davon profitieren, dass die anderen Parteien einen Vertrauensverlust erleiden, weil ihre Antworten und Taten nicht der über Jahre selbst geschürten Erwartungshaltung gerecht werden können. Eine Volksinitiative ist ganz sicher keine populistische Partei. Dennoch musste ich bei vielen Diskussionen zum Tempelhofer Feld feststellen, dass das stark vereinfachte Argument, die platte Behauptung, viel eher geglaubt wurde als die kompliziert abwägende Position.
Die Parteien haben sich gemeinsam in das immer schneller drehende Karussell aus populärer Verheißung und selbsterklärter politischer Allkompetenz gesetzt. Jetzt dürfen sie feststellen, dass es ein Teufelskreis ist, aus immer lautem Populismus, Vertrauensverlust und Frustration. Wahrscheinlich können sie nur gemeinsam wieder aussteigen. Sie sollten ein Interesse haben, genau das zu tun. Ein erster Schritt wäre nicht zu glauben, dass das mit dem Vertrauensverlust allein ein Problem der SPD sei. Es ist unser gemeinsames Problem als Demokratie.

Das Temepelhofer Feld wird auch nach dem eindeutigen Volksentscheid für Gesprächsstoff sorgen.