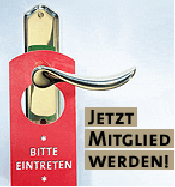AUS DER BERLINER MORGENPOST: Berliner Schüler müssen in Mathematik nachsitzen
Berlins Neuntklässler schneiden bei Naturwissenschaften im Ländervergleich erneut schlecht ab. Die Politiker sind alarmiert, die Gewerkschaft fordert mehr Geld.
Berliner Schüler haben große Probleme in naturwissenschaftlichen Fächern. Das ergibt sich aus einem aktuellen Leistungsvergleich der Bundesländer, den die Kulturministerkonferenz (KMK) am Freitag in Berlin vorgestellt hat. Bei dem Vergleichstest in Mathematik belegten die Neuntklässler aus der Berlin, wie berichtet, unter den 16 Bundesländern mit 486 Punkten nur den vorletzten Platz.Spitzenleistungen erbrachten hier Schüler aus Sachsen (536 Punkte), Brandenburg (521) und Bayern (518). Schlusslicht ist Bremen mit 471 Punkten. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 500 Punkten. Aber auch bei den Tests in Biologie (Platz 12), Chemie (Platz 13) und Physik (Platz 13) landeten Schüler aus Berlin nur im unteren Drittel.
Die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will das erneut schwache Abschneiden Berlins nicht beschönigen. "Auch wenn uns Probleme natürlich schon vorher bekannt waren, zeigt es deutlich, dass wir noch mehr tun müssen", sagte Scheeres. Die Senatorin kündigte Maßnahmen zur besseren Qualifizierung der Lehrer an. Sie will beispielsweise durchsetzen, dass bei der Ausbildung von Grundschullehrern die Fächer Deutsch und Mathematik verpflichtend werden.
"Gute Fachlichkeit des Unterrichts"
Sehr deutlich habe der Ländervergleich gezeigt, dass das A und O "eine gute Fachlichkeit des Unterrichts" sei. Tatsächlich beträgt der Abstand der Berliner Neuntklässler zum jeweils führenden Bundesland in den vier Tests jeweils zwischen 43 und 50 Punkten. Nach Angaben der Schulforscher entspricht ein Unterschied von 25 bis 30 Punkten dem Lernerfolg eines Schuljahres. Dabei hat beim ersten Bundesvergleich in Naturwissenschaften gerade der Osten Deutschlands besonders gut abgeschnitten. Mit Ausnahme Berlins lagen in allen vier getesteten Fächern die ostdeutschen Länder im oberen Drittel. Bei vorangegangenen Vergleichstests waren zuvor immer Schüler aus dem Südwesten der Republik führend gewesen.
Das Institut für Qualitätsentwicklung an der Berliner Humboldt-Universität (HU) hatte im Auftrag der KMK im Jahr 2012 die Leistungen von rund 45.000 Schülern an mehr als 1300 Schulen in ganz Deutschland überprüft. In Berlin waren 100 Schulen beteiligt. Getestet wurden ausschließlich Schüler der neunten Klassen – also zum Ende der Sekundarstufe I – und aus allen Schulformen. Dabei bescheinigen die Wissenschaftler auch den Berliner Gymnasien "signifikant unterdurchschnittliche Leistungen" im aktuellen Test.
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und schulischem Erfolg
Die Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) kritisiert hingegen die Systematik der Vergleichstests. Gerade wegen der völlig unterschiedlichen sozialen Strukturen in den einzelnen Bundesländern seien Vergleichsarbeiten nach einheitlichen Standards nicht fair, sagte GEW-Sprecher Tom Erdmann. "Hier werden Sachen miteinander verglichen, die überhaupt nicht vergleichbar sind", sagte Erdmann. Die Studie zeige aber erneut, dass Berlin in der Bildungspolitik erheblichen Nachholbedarf habe. "Der Senat muss Schulbildung wieder als Aufgabe begreifen und nicht nur als Sparpaket", forderte der GEW-Vertreter. Bildungspolitiker zeigten sich alarmiert vom schlechten Berliner Ergebnis im jüngsten Ländervergleich.
Politiker sehen in Studie deutliches Alarmzeichen
Lars Oberg, Vorsitzender des Arbeitskreises Bildung im Berliner Abgeordnetenhaus (SPD), sieht in der Studie ein deutliches Alarmzeichen. "Wir sind sehr unzufrieden mit dem Abschneiden der Berliner Schüler. Es wurde einmal mehr gezeigt, dass Bildung sehr stark von der sozialen Herkunft der Kinder abhängig ist", sagte Oberg. In Berlin würden sich soziale Probleme ballen und damit auch Bildungsschwierigkeiten. Dieser Zusammenhang müsse durchbrochen werden.
In allen 16 Bundesländern besteht der Untersuchung zufolge ein enger Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft der Kinder und ihrem schulischen Erfolg. Auch Bildungssenatorin Scheeres verweist auf die großen sozialen Problemen, die alle Stadtstädten hätten. Man werde sich jedoch nicht dahinter verstecken, dass Bremen und Hamburg in einigen Bereichen der Studie noch schlechter abgeschnitten hätten als Berlin. "Berlin muss besser werden, trotz der schwierigeren sozialen Bedingungen", sagte Scheeres.
Gewerkschaft fordert mehr Geld für Schulen
Bundesweit erreichen Schüler aus sozial besser gestellten Familien in Mathematik im Durchschnitt 82 Punkte mehr als Jugendliche aus sozial schwächer gestellten Familien. "Dies entspricht einem Leistungsvorsprung von fast drei Schuljahren zugunsten der Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Sozialstatus", schreiben die Wissenschaftler. Als eine mögliche Gegenmaßnahme benennt Oberg das vom Senat 2014 geplante "Brennpunktschulprogramm". Dafür werden im neuen Haushaltsjahr insgesamt 14 Millionen Euro bereitgestellt. Das Programm soll Schulen fördern, die über 50 Prozent Schüler haben, die von Lehrmittelzuzahlungen befreit sind. Die sei ein Indikator für soziale Benachteiligung.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) forderte mehr Geld für die Schulen. Der Senat habe insbesondere bei Räumen und pädagogischem Personal der Schulen zu sehr gespart. "Das Land Berlin muss bei der Ausstattung der Schulen wenigstens auf den Stand zurückkommen, auf dem es vor fünf Jahren schon einmal war", sagte Tom Erdmann von der GEW Berlin.
"Lehrer müssen auch uninteressierte Kinder begeistern"
Für Katrin Schultze-Berndt (CDU), Vorsitzende des Landesfachausschusses Schule und berufliche Bildung, liegt hingegen der Schwerpunkt der künftigen Arbeit bei der Begeisterungsfähigkeit der Lehrer. "Oftmals sind Fächer wie Mathe nicht so beliebt bei Schülern wie beispielsweise Sprachen. Da brauchen wir Lehrer, die auch uninteressierte Kinder begeistern", sagte sie. Dies solle auch in der Ausbildung der Lehrer stärker in den Vordergrund gerückt werden. "Derzeit wird zu stark darauf gesetzt, dass Kinder selbst lernen und ihr Wissen in Hausaufgaben vertiefen – darauf können wir uns nicht verlassen", so Schultze-Berndt.
Özcan Mutlu, Bildungspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, ist von dem katastrophalen Ergebnis nicht überrascht. "Die Studie ist ein Schlag ins Gesicht der jahrelangen SPD-Bildungspolitik. Seit Jahren wird von Reformen gesprochen. Nichts wird richtig umgesetzt", sagt Mutlu. Aus seiner Sicht muss nun wirklich Geld in die Hand genommen werden um die Berliner Bildung zu retten. Gute Absichten würden nicht reichen.
- Berliner Morgenpost